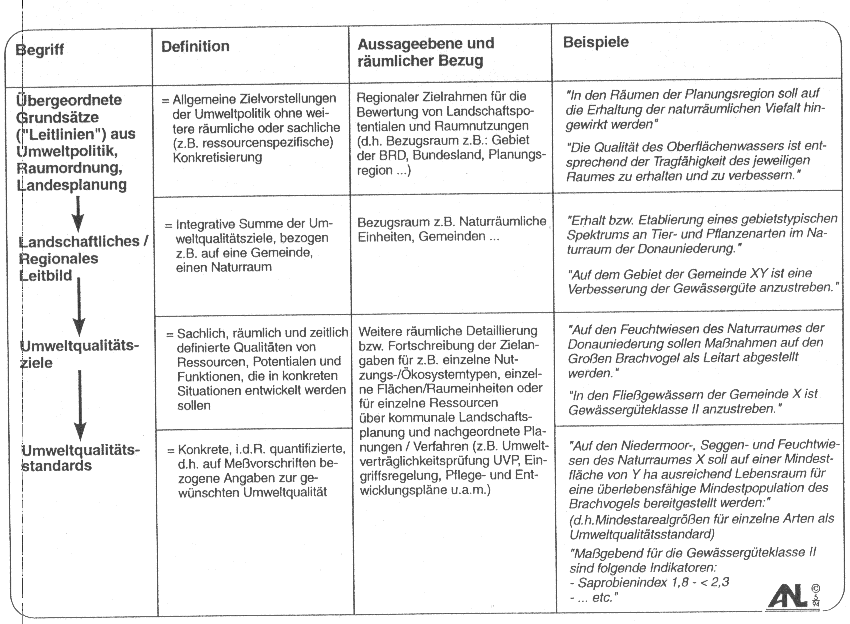
3 Landschaftsplanung - Sorgenkind von Naturschutz und Landschaftspflege
Die heutige Landschaftsplanung entwickelte sich aus der vorwiegend optisch motivierten Gartenarchitektur und der `Landesverschönerung´ am Anfang des letzten Jahrhunderts, unterstützt durch die am Ende des 19. Jhd. entstandene `Heimatschutzbewegung´ (BMU, 1993; Zielonkowski, 1992). Die Notwendigkeit der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen wurde allerdings erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts erkannt, was sich in Deutschland auf politischer Ebene in der Verabschiedung des Bundesnaturschutzgesetzes 1976, und in seiner Folge in jeweiligen Ländergesetzen, niederschlug. Im folgenden soll Landschaftsplanung als Planungsinstrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht grundlegend dargestellt werden. Hier sollen ausschnitthaft die im Rahmen der Arbeit interessierenden Aspekte herausgegriffen werden. Dazu zählen die Bürgerbeteiligung bei der Planaufstellung, die Defizite in der Maßnahmenumsetzung und aktuelle Diskussionen im Naturschutz. Lösungsansätze sollen als Perspektiven vorgestellt werden.
Zur Verwirklichung der aktuellen und zukünftigen Ziele und Ansprüche von Naturschutz und Landschaftspflege wurde die dreistufige Landschaftsplanung eingeführt mit Landschaftsprogramm auf Landes- und Landschaftsrahmenplan auf Regionalebene, sowie dem Landschaftsplan zur Darstellung ihrer örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen (vgl. §§ 5, 6 BNatSchG). Demgegenüber verfolgt die Eingriffsregelung des § 8 BNatSchG die Verhinderung, die Minimierung bzw. die Kompensation der negativen Nebenwirkungen von Planungs- bzw. Bauvorhaben auf Natur und Landschaft. Die beiden Instrumente, kommunaler Landschaftsplan und Eingriffsregelung, laufen demnach zwar auf gleichen Flächen ab, unterscheiden sich aber bzgl. ihrem zeitlichen Bezugsbild: der Landschaftsplan versucht eine Flächensicherung für die Zukunft, die Eingriffsregelung ist um die Beibehaltung des Status quo bemüht (vgl. Heidtmann, 1993).
3.1 Bisherige Formen der Bürger- und Verbandsbeteiligung bei der Planaufstellung
Wie in Kapitel 1 angedeutet, wird frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Förderung von Akzeptanz im folgenden Kapitel propagiert werden. Daher sollen hier zunächst die bisherigen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen erläutert werden. Eine kurze Darstellung der in den Bundesländern unterschiedlich durchgeführten rechtlichen Einbindung der Landschaftspläne in die Bauleitplanung folgt in Kapitel 3.1.4.
Für die Begriffe `Beteiligung´, `Bürgerbeteiligung´ und `Partizipation´ wurde bisher keine allgemeingültige Definition vom Gesetzgeber oder in der Rechtslehre entwickelt. Aus dieser unklaren Begriffslage heraus werden sie im Alltagsgebrauch nebeneinander benutzt. Das Ende der 1960er Jahre aus englischsprachiger Literatur als Anglizismus in die deutsche Sprache eingeführte Wort `Partizipation´ setzte sich nicht nur als eigenständiger Begriff durch, sondern erwarb auch die Funktion eines Überbegriffs für Formen der Bürgerbeteiligung (Strubelt, 1995). Wickrath (1992, 10) verweist auf die Schwierigkeit einer Definition, da Sinn und Zweck der Bürgerbeteiligung wesentlich von der jeweiligen Rechtsnorm abhängt, deren Bestandteil sie ist und umschreibt sie für das Recht der Raumordnung und Landesplanung als "institutionalisierte und außerhalb der allgemeinen Wahlen zu den Vertretungskörperschaften sowie der Mitgliedschaft in politischen Parteien erfolgende Teilhabe der Bürger an Verwaltungsentscheidungen in verschiedenen Intensitätsstufen" (eb., 11).
Unter dieser Begriffsfassung können drei Formen der Bürgerbeteiligung unterschieden werden (Soell, 1982; Hoppe/Erbguth, 1984; Wickrath, 1992):
"Die Bürger sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihnen ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben."
Diese Beteiligungsformen machen deutlich, daß grundsätzlich unterschieden wird zwischen der direkten Beteiligung der Bürger und der indirekten über Verbände. Die Unmittelbarkeit der Naturschutzbeiräte ergibt sich daraus, daß die Räte als Personen den jeweiligen Minister beraten. Als Beteiligungsform allerdings ist es dennoch als indirekt einzustufen, da die beratenden Personen aus verschiedenen Verbänden oder Institutionen stammen. Dem Repräsentationsprinzip wird somit auch bei der gesellschaftlichen Interessenvertretung, und nicht nur in der politischen durch Wahlen, zur Geltung verholfen (vgl. Strubelt, 1995).
Durch die Ländergesetzgebungskompetenz im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 GG variieren die Möglichkeiten für Bürger, sich an der Landschaftsplanung zu beteiligen. Zwar werden regelmäßig betroffene Behörden, Träger öffentlicher Belange oder Verbände beteiligt, aber für den betroffenen Bürger als `Ottonormalverbraucher´ sind die Möglichkeiten mitunter eingeschränkt. Tabelle 1 gibt einen Überblick die gesetzlich vorgesehenen Formen in den jeweiligen Bundesländern.
Die Regelungen zur Bürgerbeteiligung in der Landschaftsplanung sind ein Abbild der in Kapitel 3.1.1 vorgestellten Formen und gehen zwei Wege: entweder es wird, wie mehrheitlich geschehen, eine direkte Beteiligung über Äußerungs- und Erörterungsrechte gewährt, oder es wird die Repräsentationsschiene gefahren. Zwar ist nach Lage der Gesetze in den überwiegenden Fällen eine frühzeitige Beteiligung der Bürger bei der kommunalen Landschaftsplanung vorgesehen, eine weitergehende Beteiligung bei der Entscheidungsvorbereitung besteht aber in keinem Land.
Verbände vereinen Interessen und gesellschaftliches Engagement und
artikulieren gemeinsame Belange. Sie sollen durch ihre Mitarbeit und ihren Sachverstand
zur `Problemerhellung´ beitragen, womit ein breiteres Fundament für ihre
Interessenberücksichtigung gelegt wird. Die Grenzen ihrer Mitwirkung finden sich in der
Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz gem. Art. 20 Abs. 3 GG, wonach sie "nicht
mitbestimmend in die Kompetenzen von
Tabelle 1: Übersicht über die Formen der Bürgerbeteiligung in der kommunalen Landschaftsplanung in den Bundesländern. (Quelle: eigene Zusammenstellung)
| Land | Fundstelle | Beteiligungsmöglichkeit |
| Baden-Württemberg | § 9 Abs. 1 NatSchG BW |
für Bürger nicht vorgesehen, nur für Verbände und Träger öffentlicher Belange |
| Bayern | Art. 3 Abs. 5 ByNatSchG |
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Berlin | § 11 BlnNatSchG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung (Anhörung) |
| Brandenburg | § 8 Abs. 2 BbgNatSchG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Bremen | § 8 Abs. 1 BremNatSchG | für Bürger nicht vorgesehen, nur für Verbände und Träger öffentlicher Belange |
| Hamburg | § 7 Abs. 3 HmbNatSchG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Hessen | § 3a Abs. 2 HeNatG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung |
| Mecklenburg-Vorpommern | § 16 NatSchG MV | bis zum Inkrafttreten eines Landesnaturschutzgesetzes für Bürger nicht vorgesehen |
| Niedersachsen | § 6 NdsNatSchG | Vorbringen von Bedenken und Anregungen |
| Nordrhein-Westfalen | § 27b LG NW | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung |
| Rheinland-Pfalz | § 17 LPflG RP | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Saarland | § 8 Abs. 7 SNG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Sachsen | § 7 Abs. 2 SächsNatSchG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
| Sachsen-Anhalt | § 7 NatSchG LSA | nicht vorgesehen |
| Schleswig-Holstein | § 6 Abs. 2 LNatSchG SH | die Gemeinden beteiligen die Öffentlichkeit |
| Thüringen | § 5 Abs. 1 VorlThürNatG | Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 BauGB |
Verwaltung und Parlament eingreifen" (Wolf, 1994, 4) dürfen. Die
oben bereits erwähnte
Möglichkeit der Verbandsbeteiligung über § 29 Abs. 1 BNatSchG und den jeweiligen
Ländergesetzen durch Einsichts- und Anhörungsrecht, wovon auch insbesondere bei
Planfeststellungsverfahren häufig gebrauch gemacht wird, kann durch das Instrument der
Verbandsklage erweitert werden. (Gassner, 1991; Wolf, 1994)
Bei der Verbandsklage kann ein nach § 29 Abs. 2 BNatSchG anerkannter Verein, ohne die durch § 42 Abs. 2 VwGO geforderte Verletzung subjektiver Rechte, Klage gegen eine Verwaltungsentscheidung erheben, wenn die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nicht ausreichend gewahrt wurden (Gassner et al., 1996, 613ff.; Rehbinder, 1994). Auf Bundesebene ist die Verbandsklage bisher nicht möglich. Versuche, sie in eine Novellierung des BNatSchG aufzunehmen scheiterten mehrfach an der Regierungskoalition (vgl. Hauber, 1991 und Müller, 1993). Auf Länderebene dagegen wurde sie von mittlerweile zwölf Ländern in die jeweiligen Landesgesetze aufgenommen.
In keinem Bundesland ist die Verbandsklage im Zusammenhang mit kommunaler Landschaftsplanung einsetzbar. Dies wird einstimmig aufgrund mangelnder Rechtsgrundlage abgelehnt, da analog zu § 2 Abs. 3 BauGB kein Anspruch auf Erlaß bestimmter Planungen besteht und Landschaftsplanung nur öffentliche Planungsträger dirigieren kann (Hahn, 1991, 272f.; im Ergebnis ebenso: Wolf, 1994, 7).
Das Bundesnaturschutzgesetz läßt in § 6 Abs. 4 BNatSchG den Ländern relativ freie Hand, Verfahren und Verbindlichkeit der Landschaftspläne in Landesrecht umzusetzen:
"Die Länder bestimmen die für die Aufstellung der Landschaftspläne zuständigen Behörden und öffentlichen Stellen. Sie regeln das Verfahren und die Verbindlichkeit der Landschaftspläne, insbesondere für die Bauleitplanung. Sie können bestimmen, daß Darstellungen des Landschaftsplanes als Darstellungen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne aufgenommen werden".
Entsprechend ist die entstandene Regelungsvielfalt. Drei unterschiedliche Methoden der Umsetzung können zusammengefaßt werden (Hahn, 1991; Ramsauer, 1993; Gassner, 1995):
Gemäß dem Grundsatz, daß Abhilfe nur dann geschaffen werden kann, wenn die Probleme erkannt sind, soll zunächst ein Überblick über die in der Fachliteratur angeführten Umsetzungsmängel in der Landschaftsplanung gegeben werden.
Der Versuch, den Umsetzungsmängeln von Landschaftsplänen durch Literaturanalyse auf die Spur zu kommen, ist in Tabelle 2 wiedergegeben. Sicherlich ist die Aufstellung nicht endgültig und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie gibt aber einen Einblick in den Diskussionsstand und die Meinungsvielfalt und berücksichtigt die zeitliche Entwicklung seit der ersten Bilanz des DRL (1984), dem grundlegenden Gutachten von Kiemstedt/Wirz (1990) bis zum RSU (1996b). Auch die Aufteilung der Mängel in politisch-administrative, naturschutzfachliche und inhaltlich-methodische kann kritisch hinterfragt werden, da eine korrekte Zuteilung zu einer der drei Fallgruppen nicht immer sauber erfolgen kann. Der Übersichtlichkeit wegen sollte darauf aber nicht verzichtet werden.
Die in der Literatur angesprochenen Mängel beziehen sich auf ein weites Problemfeld, die auch für andere Planungsbereiche gelten bzw. gelten könnten. So kann bspw. der Mangel an Fachpersonal und Finanzmitteln sicher als ein generelles administratives Problem eingestuft werden. Weiterhin sind Mängel wie die Planerstellung durch fachlich nicht kompetente Planer im Laufe der Zeit durch Ausbildungsgänge zu Landschaftsplanung- und pflege an Hochschulen und Fachhochschulen beseitigt worden.
Inwieweit mangelnde Betroffenenbeteiligung auch ein Faktor für schlechte Umsetzung ist, wurde erstmals bei Kaule et al. (1994) untersucht, die auf die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen abheben. Hierauf wird gesondert in Kapitel 3.4 und 4.1 eingegangen.
Tabelle 2 : Zusammenstellung der Gründe für die Umsetzungsprobleme von Landschaftsplänen (Reihenfolge der Nennung bedeutet keine Wertung) (Quelle: eigene Zusammenstellung)
politisch-administrative |
naturschutzfachliche |
inhaltlich-methodische |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Mangel an Fachpersonal, Finanz- und
Sachmitteln (z.B. für Flächenkauf, Ausführungstechnischer Dienst für Pflegearbeiten) Schmid, 1984; Sollmann, 1984; Brahms et al., 1988; RSU, 1988; Hübler, 1988; Kiemstedt/ Wirz, 1990; Heidtmann, 1993; RSU, 1996b; Zeidler, 1996 |
mangelndes Problembewußtsein bzw. Unkenntnis
von ökologsichen Zusammenhängen und schwer vermittelbare Naturschutzziele, daher
Geringschätzung bei politischen Entscheidungsträgern Grebe, 1984; Rathfelder, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
ideologische vorgebrachte Existenzbedrohungen
einzelner Interessengruppen, statt sachliche Erörterung bzw. Panikmache gegen drohende
Landenteignung in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften Heidtmann, 1993; Möller, 1996 |
2 |
Organisationsgrad der Naturschutzverwaltung
schlechter als bei anderen Raumnutzern (keine durchgängige Zuständigkeit eines
Ministeriums; mangelnde Selbständigkeit der Naturschutzbehörden) Schmid, 1984; Pohl, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; Heidtmann, 1993 |
es existieren keine konkreten Schutzziele für
Naturraumpotentiale bzw. keine Wertmaßstäbe (Naturschutzqualitätsziele) als
Ausgangspunkt für Bewertungen Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; Hahn, 1991; von Haaren, 1988 |
Wichtigkeit einer effektiven Projektsteuerung
in Naturschutz und Landschaftspflege werden bisher unterschätzt Kaule et al., 1994; Werkmeister, 1984 |
3 |
mangelnde Wertschätzung und Lobby des
Naturschutzes bzw. mangelnder politischer Wille und mangelnde Akzeptanz der
Landschaftsplanung bei Gemeinden; ökonomische Interessen (Gewerbe, Siedlung) stehen im
Vordergrund Pohl, 1984; Schmid, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b; Zeidler, 1996 |
Schwerpunkt der Pläne liegt auf Analyse und
Bewertung, nicht auf Umsetzung bzw. zu wenig Bewertung Bewertungshokuspokus Hübler, 1988; Hahn, 1988 |
einseitige Ausbildung der Planer:
Prozeßschutz und abiotischer Rssourcenschutz werden nicht wahrgenommen Zeidler, 1996 |
4 |
Konfliktvermeidung mit anderen
Planungsabsichten Kiemstedt/Wirz, 1990; Kaule et al., 1994; RSU, 1996b |
keine einheitlichen Bewertungsverfahren Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Planerstellung dauer zu lange Hübler, 1988; RSU, 1996b |
5 |
mangelnde inhaltliche Präzisierung der
Anforderungen an den Landschaftsplan Sollmann, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Beschränkung der Analyse und Bewertung auf
Arten- und Biotopschutz Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
Kommunikationsprobleme und
Vermittlungsschwächen zwischen den Planungsbeteiligten Kaule et al. 1994 |
6 |
Bürgerbeteiligung nicht ausreichend geregelt,
dadurch mangelnde Unterstützung/Interesse seitens der Bevölkerung Sollmann, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
fehlende aktive Informationspolitik seitens
des Naturschutzes Grebe, 1984; Heidtmann, 1993 |
Planinhalte sind nur fachwissenschaftlich,
aber nicht allgemeinverständlich abgefaßt Rathfelder, 1984; Heidtmann, 1993; RSU, 1996b |
7 |
fehlende Kontrollmöglichkeit des
Verwaltungshandeln durch den Bürger Brahms et al., 1988 |
fehlende Datengrundlage über Naturhaushalt Pohl, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Querschnittsaufgabe greift in
Ressortverständnis anderer Fachplanungen ein Kiemstedt/Wirz, 1990; Heidtmann, 1993 |
8 |
gesetzliche Regelungsvielfalt der Länder
schafft ein uneinheitliches Bild der Landschaftsplanung und schwächt der Stellung bzw.
kein einheitliches Planungsverständnis der Länder Hübler, 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
kein Monitoring von Veränderungen/keine
Erfolgskontrollen Sollmann, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; Zeidler, 1996 |
Landschaftsplanung hat kein spezifisches
Klientel, daß von Maßnahmen ökonomisch profitiert Heidtmann, 1993; RSU, 1996b |
9 |
nicht angepaßte HOAI Metzner, 1984; Pohl, 1984; Werkmeister 1984; RSU, 1996b |
sozio-ökonomische "Blindheit" der
ökologischen Fachplanung RSU, 1996b |
Pläne werden von nicht-kompetenten Planern
erstellt Metzner, 1984; Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
10 |
Vertreter von anderen landschaftsmutzenden
Behörden (Land- und Forstwirtschaft; Jagd) werden als Naturschutzbeauftragte berufen Schmid, 1984 |
keine eigenen Implementierungsinstrumente der
Landschaftsplanung (wie bspw. die Flurbereinigung) Hübler, 1988; RSU, 1996b |
Bei den naturschutzfachlichen Mängeln stehen fehlende Leitbilder und Naturschutzqualitätsziele seit einiger Zeit besonders in der Diskussion (vgl. Jessel, 1994b; Plachter, 1995). Der Begriff des "Leitbildes" hat dabei auf anderen Planungsebenen schon länger Einzug in das jeweilige Fachvokabular gehalten. Storbeck (1982, 211) verweist auf seine Einführung in der Raumplanung bereits in den 1950er Jahren als Zusammenschau von in die Zukunft gerichteter gesellschaftlicher Oberziele. Für die Stadtplanung werden ebenfalls die 1950er und frühen 60er Jahre als Zeitraum genannt, in dem die Diskussion um städtebauliche Leitbilder einen breiten Raum einnahm (Krautzberger, 1990, 51). Auch heute findet der Begriff in diesen Planungsfeldern Anwendung. Im "Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen" des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau werden Leitbilder für die räumliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland entworfen, auf deren Grundlage "Vorschläge für die Konkretisierung von handlungsorientierten Maßnahmen erarbeitet werden" (BMBau, 1993, III) sollen.
Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hat dieses Thema in seinem jüngsten Umweltgutachten aufgegriffen und fordert:
"Zukünftig erscheint es erforderlich, regionalisierte und nutzungsbezogene Qualitätsziele und Mindeststandards für den Natur- und Landschaftsschutz zu entwickeln und anzuwenden, die die unterschiedliche Naturausstattung und das entsprechende Naturschutzpotential sowie die jeweilige Nutzung berücksichtigen" (RSU, 1996a, 124).
Mit der Forderung nach Beachtung der jeweiligen, regionstypischen Schutz- und Nutzungsmöglichkeiten hat er grundlegend abgesteckt, woran sich Leitbilder und Qualitätsziele zu orientieren haben. Die Landschaftsplanung als Fachplanung für Naturschutz und Landschaftspflege würde durch solche hierarchisch aufeinander aufbauenden Zielaussagen dadurch profitieren, daß auf diese Art eine einheitliche Bewertungsgrundlage für Veränderungen in der Landschaft geschaffen werden (Jessel, 1996).
Gesucht werden in hierarchischer Abstufung als Leitbilder,
Soll-Zustände oder als Qualitätsziele formulierte Aussagen, um die oftmals
divergierenden Auffassungen des Naturschutzes nach außen hin vermittelbar zu machen und
um eine Vergleichsgrundlage für Ist-/Soll-
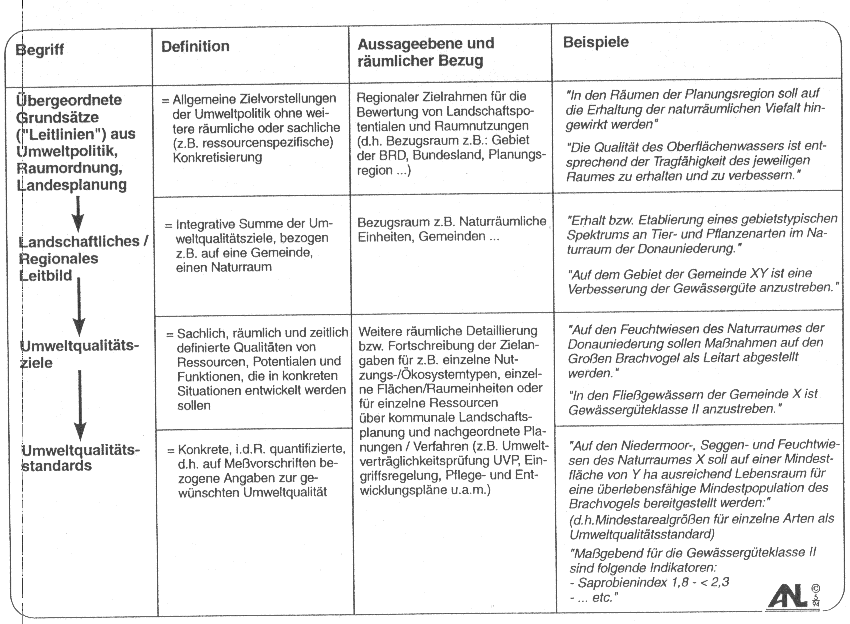
Tabelle 3: Mögliche Hierarchie eines naturschutzfachlichen Zielsystems mit Definitionen, Bezugsraum und Beispielen. Von allgemeinen Aussagen ausgehend werden sie "nach unten hin" konkreter und es wird versucht, mit Zahlen zu argumentieren. (Quelle: Jessel, 1994b, 6)
Bewertungen zu schaffen (Marzelli, 1994; Plachter, 1995). Für die Bereiche Boden-, Gewässer-, Arten- und Biotopschutz haben Fürst et al. (1992) in einem umfangreichen Forschungsbericht über 2100 Umweltqualitätsziele für die Bundesrepublik Deutschland erhoben, wovon allein auf den Gewässerschutz 72% (über 1500), auf den Arten- und Biotopschutz 14,2% und auf den Bodenschutz 12,6% entfielen. Die gute Handhabbarkeit (Aufstellung und Überwachung) von Grenzwerten im Bereich Gewässer durch die Entwicklungen in der Meßtechnik erklären diese deutliche Diskrepanz. Tabelle 3 verdeutlicht eine mögliche Hierarchie eines naturschutzfachlichen Zielsystems mit Definitionen, Bezugsraum und Beispielen aus dem Biotop- und Gewässerschutz.
Zunächst wurden Leitbilder für die drei Bereiche biotischer, abiotischer und ästhetischer Ressourcenschutz gefordert (vgl. bspw. Pfadenhauer, 1988; Marzelli, 1994). Plachter (1995) hingegen unterscheidet sechs wichtige sektorale Leitbilder, die sich an voneinander unabhängigen Zielvorstellungen orientieren (vgl. Abbildung 1). Sie benötigen unterschiedliche Grundinformationen (Datenquellen), folgen anderen Schlüsselfragen und können je nach Landschaft in ihrer Gewichtung variiert werden. Über einen Vergleich der Ist-/Soll-Zustände können Qualitätsziele definiert und mittels der um die "partielle Segregation" erweiterten Integrations- und Segregationsstrategien in die Landschaft umgesetzt werden:
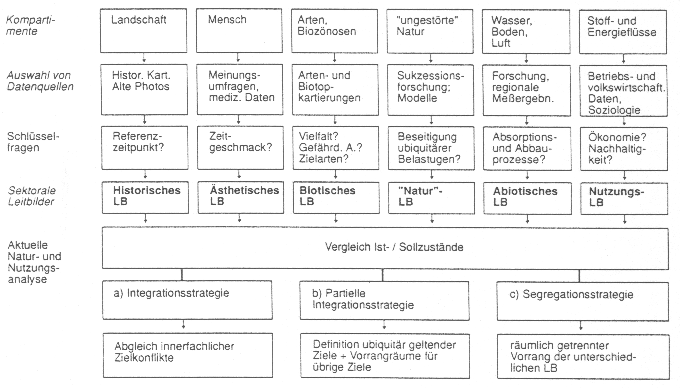
Abbildung 1: Zunächst unabhängig voneinander abgeleitete sektorale Leitbilder können über einen Ist-/Sollvergleich in eine Strategie der Integration, Segregation oder der partiellen Segregation auf einen Landschaftsraum vereint werden. (Quelle: Plachter, 1995, 229)
Untersucht man die Konzeptionen zu Qualitätszielen im Naturschutz hinsichtlich der Aufstellung ihrer Ziele oder Soll-Zustände, dann stößt man teilweise auf wenig konkrete Aussagen, wie dies geschehen soll. Durch einen Vergleich von verschiedenen Konzepten, der durchaus kritisch zu betrachten ist, da die verwendeten Begriffe in allen Ansätzen variieren, können drei Herangehensweisen zur Aufstellung von Qualitätszielkonzepten unterschieden werden, die in Tabelle 4 aus den jeweiligen Beispielen abgeleitet sind.
Der Ansatz Pfadenhauers (1988) zu Naturschutzstrategien und -ansprüchen gilt eingeschränkt auf landwirtschaftliche Nutzflächen. Ihre Formulierung wird abgeleitet aus den Defiziten des Ist-Zustands, wobei für den optimalen Soll-Zustand zahlreiche Erfahrungen über Tier- und Pflanzengesellschaften, z.B. aus der Pflanzensoziologie, zur Verfügung stehen. Bei der Defizitbestimmung wird der anzustrebende Soll-Zustand als vorgegebene Größe bereits vorausgesetzt.
Tabelle 4: Herangehensweisen zur Aufstellung von Qualitätszielkonzeptionen im Naturschutz. Aus den bisherigen Beispielen wurden drei Grundformen abgeleitet, die durch biologisch-quantitative Methoden, oder durch einen naturschutzfachlichen bzw. gesellschaftlichen Diskussionsprozeß gekennzeichnet sind. (Quelle: eigene Zusammenstellung)
politisch-administrative |
naturschutzfachliche |
inhaltlich-methodische |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Mangel an Fachpersonal, Finanz- und
Sachmitteln (z.B. für Flächenkauf, Ausführungstechnischer Dienst für Pflegearbeiten) Schmid, 1984; Sollmann, 1984; Brahms et al., 1988; RSU, 1988; Hübler, 1988; Kiemstedt/ Wirz, 1990; Heidtmann, 1993; RSU, 1996b; Zeidler, 1996 |
mangelndes Problembewußtsein bzw. Unkenntnis
von ökologsichen Zusammenhängen und schwer vermittelbare Naturschutzziele, daher
Geringschätzung bei politischen Entscheidungsträgern Grebe, 1984; Rathfelder, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
ideologische vorgebrachte Existenzbedrohungen
einzelner Interessengruppen, statt sachliche Erörterung bzw. Panikmache gegen drohende
Landenteignung in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften Heidtmann, 1993; Möller, 1996 |
2 |
Organisationsgrad der Naturschutzverwaltung
schlechter als bei anderen Raumnutzern (keine durchgängige Zuständigkeit eines
Ministeriums; mangelnde Selbständigkeit der Naturschutzbehörden) Schmid, 1984; Pohl, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; Heidtmann, 1993 |
es existieren keine konkreten Schutzziele für
Naturraumpotentiale bzw. keine Wertmaßstäbe (Naturschutzqualitätsziele) als
Ausgangspunkt für Bewertungen Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; Hahn, 1991; von Haaren, 1988 |
Wichtigkeit einer effektiven Projektsteuerung
in Naturschutz und Landschaftspflege werden bisher unterschätzt Kaule et al., 1994; Werkmeister, 1984 |
3 |
mangelnde Wertschätzung und Lobby des
Naturschutzes bzw. mangelnder politischer Wille und mangelnde Akzeptanz der
Landschaftsplanung bei Gemeinden; ökonomische Interessen (Gewerbe, Siedlung) stehen im
Vordergrund Pohl, 1984; Schmid, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b; Zeidler, 1996 |
Schwerpunkt der Pläne liegt auf Analyse und
Bewertung, nicht auf Umsetzung bzw. zu wenig Bewertung Bewertungshokuspokus Hübler, 1988; Hahn, 1988 |
einseitige Ausbildung der Planer:
Prozeßschutz und abiotischer Rssourcenschutz werden nicht wahrgenommen Zeidler, 1996 |
4 |
Konfliktvermeidung mit anderen
Planungsabsichten Kiemstedt/Wirz, 1990; Kaule et al., 1994; RSU, 1996b |
keine einheitlichen Bewertungsverfahren Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Planerstellung dauer zu lange Hübler, 1988; RSU, 1996b |
5 |
mangelnde inhaltliche Präzisierung der
Anforderungen an den Landschaftsplan Sollmann, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Beschränkung der Analyse und Bewertung auf
Arten- und Biotopschutz Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
Kommunikationsprobleme und
Vermittlungsschwächen zwischen den Planungsbeteiligten Kaule et al. 1994 |
6 |
Bürgerbeteiligung nicht ausreichend geregelt,
dadurch mangelnde Unterstützung/Interesse seitens der Bevölkerung Sollmann, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990; RSU, 1996b |
fehlende aktive Informationspolitik seitens
des Naturschutzes Grebe, 1984; Heidtmann, 1993 |
Planinhalte sind nur fachwissenschaftlich,
aber nicht allgemeinverständlich abgefaßt Rathfelder, 1984; Heidtmann, 1993; RSU, 1996b |
7 |
fehlende Kontrollmöglichkeit des
Verwaltungshandeln durch den Bürger Brahms et al., 1988 |
fehlende Datengrundlage über Naturhaushalt Pohl, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
Querschnittsaufgabe greift in
Ressortverständnis anderer Fachplanungen ein Kiemstedt/Wirz, 1990; Heidtmann, 1993 |
8 |
gesetzliche Regelungsvielfalt der Länder
schafft ein uneinheitliches Bild der Landschaftsplanung und schwächt der Stellung bzw.
kein einheitliches Planungsverständnis der Länder Hübler, 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
kein Monitoring von Veränderungen/keine
Erfolgskontrollen Sollmann, 1984; Brahms et al., 1988; Kiemstedt/Wirz, 1990; Zeidler, 1996 |
Landschaftsplanung hat kein spezifisches
Klientel, daß von Maßnahmen ökonomisch profitiert Heidtmann, 1993; RSU, 1996b |
9 |
nicht angepaßte HOAI Metzner, 1984; Pohl, 1984; Werkmeister 1984; RSU, 1996b |
sozio-ökonomische "Blindheit" der
ökologischen Fachplanung RSU, 1996b |
Pläne werden von nicht-kompetenten Planern
erstellt Metzner, 1984; Schmid, 1984; Kiemstedt/Wirz, 1990 |
10 |
Vertreter von anderen landschaftsmutzenden
Behörden (Land- und Forstwirtschaft; Jagd) werden als Naturschutzbeauftragte berufen Schmid, 1984 |
keine eigenen Implementierungsinstrumente der
Landschaftsplanung (wie bspw. die Flurbereinigung) Hübler, 1988; RSU, 1996b |
Haber/Duhme entwerfen mit dem Einsatz eines Geographischen Informationssystems (GIS) zwar einen modernen Weg, der aber auf Daten angewiesen ist, die in gleicher Qualität für einen großflächigen Bezugsraum kaum erhoben sind. Ihre großzügige Formulierweise kann nicht über die Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die mit der Einführung und der damit verbundenen Aufbereitung von Daten für ein GIS einher gehen. Der naturschutzfachliche Ansatz, bei dem die Bürger von Fachleuten des Naturschutzes über die zukünftige Entwicklung und das Aussehen ihrer Landschaft entscheiden lassen müssen, greift zu kurz. Der ästhetische Ressourcenschutz bzw. das Landschaftsbild, das den Bewohnern einer Region das jeweilige Heimatgefühl vermittelt, wird hierbei nicht ausreichend berücksichtigt, ein Kritikpunkt, der auf den biologisch-quantitativen Weg ebenso zutrifft.
Zwar ohne speziellen Raumbezug formuliert, aber dennoch mit Vorschlägen zur Aufstellung von Qualitätszielkonzeptionen, weist sich Marzellis (1994) Ansatz aus. Seine Forderung zur Einbeziehung aller gesellschaftlicher Gruppen in einen demokratischen Meinungsfindungsprozeß scheint am aussichtsreichsten, da hier durch den prozeßhaften Charakter von Moderations- und Mediationsverfahren (siehe hierzu Kapitel 4) verschiedenste Meinungen und Ansichten in die Aufstellung von Leitbildern und Qualitätszielen eingehen können. Der räumlich gebundene Ansatz von Heidt et al. (1994) ist zwar in dieser Hinsicht weniger konkret, weist aber durch die Forderung nach Legitimation durch Gesellschaft oder deren Entscheidungsträger in die gleiche Richtung.
Die oben dargestellten Mängel und Probleme der Landschaftsplanung lassen es notwendig erscheinen, Perspektiven aufzuzeigen, wie in Zukunft eine Verbesserung der Umsetzung und damit ein Einhalten des gesetzlichen Auftrags zu Schutz, Pflege und Entwicklung des Natur- und Landschaftshaushaltes erreicht werden könnte. Es sollen Ansätze umrissen werden, die sich um Fragen der Beteiligung, Kooperation und Akzeptanz drehen.
Kaule et al. (1994, 109f.) stellen in ihrem Gutachten ein Schweizerisches Modell vor, daß bessere Umsetzungschancen durch die Durchmischung von Planungs- und Umsetzungsphase sieht:
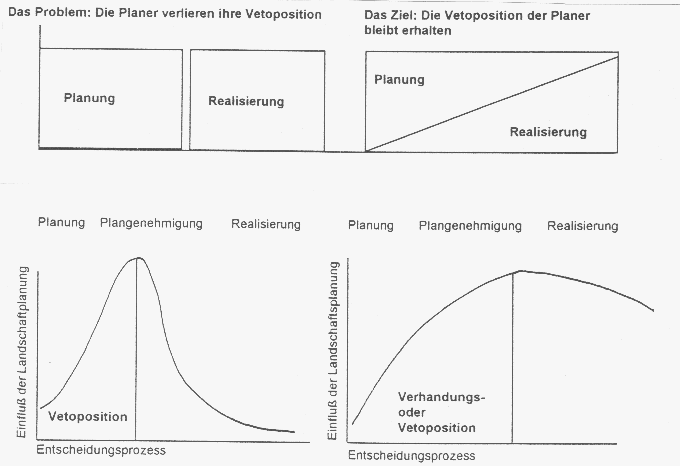
Abbildung 2: Bessere Umsetzungschancen durch die Durchmischung von Planungs- und Umsetzungsphase. Im Gegensatz zur bisherigen Handhabung werden die Planer auch bei der Umsetzung der in der Planung geforderten Maßnahmen beteiligt und können ihre Fachkompetenz einbringen. (Quelle: Kaule et al., 1994, S. 109)
In Abbildung 2 wird die bisherige Problematik und die Durchmischung optisch dargestellt. Während links Planung und Umsetzung zeitlich getrennt sind und die Planer bei der Realisierung der Planung ausgeschaltet sind, erhalten sie rechts eine stärkere Position durch Monitoring und Evaluation ("Veto-Rechte der Planer"). In einer Untersuchung zur Umsetzung von Landschaftsplanung von von Haaren hat es sich ebenfalls "als wichtig erwiesen, daß Planung und Umsetzung nicht mehr als getrennte Prozesse behandelt werden" (1991, 33). Heidtmann (1993, 71) dagegen warnt vor dieser Konstellation, da hier die Planungsphase schon mit Problemen der Umsetzung belastet werden, verkennt aber den Prozeßcharakter, den die Planung dadurch annimmt.
Schon 1984 vermutete Werkmeister in einer ersten Bilanz über Landschaftsplanung in Niedersachsen, daß durch Planungsmanagement die Qualität von Landschaftsplanung verbessert werden kann: "Was den Landschaftsplan selbst betrifft, so kann ein gutes Ergebnis erwartet werden, wenn ein Amt und eine projektbegleitende Gruppe die Planung betreuen und wenn durch entsprechende Zwischenberichte und Erläuterungen eine demokratische und realistische Planung ermöglicht wird" (1984, 481). Zehn Jahre Später konnten Kaule et al. in ihren untersuchten Fallbeispielen zeigen, "daß die Wichtigkeit einer effektiven Projektsteuerung in Naturschutz und Landschaftspflege bisher noch unterschätzt wird" (1994, 101). Weiterhin erkennen sie die Notwendigkeit, in Zukunft Verwaltungs- und Managementtechniken zur Initiierung und Durchführung von Umsetzungsprojekten zu fördern: "Die größte Gemeinsamkeit in allen vier Erprobungsverfahren war eine meßbare Steigerung des Umsetzungserfolgs durch die Etablierung von `Umsetzungskoordinatoren vor Ort´" (eb., 114).
Den Gedanken der Projektsteuerung greift auch der RSU in seinem jüngsten Sondergutachten auf. Als Voraussetzung für eine bessere Umsetzung der Ziele der Landschaftsplanung sieht er eine stärkere Nutzerorientierung, Kooperation sowie Projektbezogenheit der Planung. Darüber hinaus kann die Umsetzungschance durch Einbeziehung sozioökonomischer Kriterien in den Planungsprozeß gesteigert werden. (RSU, 1996b, 62)
3.4.3 Systematische Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Umweltverbände
Eine mangelnde Wertschätzung für Naturschutzbelange resultiert in weiten Kreisen der Bevölkerung, und auch gerade bei politischen Entscheidungsträgern, oftmals aus Unkenntnis ökologischer Zusammenhänge bzw. naturhaushaltlicher Sachkunde (z.B. Geisler, 1995, 91). An dieser fehlenden Kenntnis muß die systematische Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Umweltverbände zunächst einsetzen. Informationsarbeit in Natur und Landschaft muß "auf die Vermittlung von Sachkenntnissen zu umweltrelevanten Themen" (Job et al., 1993, 14) abzielen, wohingegen Öffentlichkeitsarbeit bestrebt ist, "durch geplantes und dauerhaftes Bemühen gegenseitiges Verständnis und Vertrauen für die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes aufzubauen" (eb., 14). Für haas (1988) ist es dringend erforderlich, Naturschutz in der Bevölkerung so verständlich zu machen, daß jeder einzelne für sich das Positive von Naturschutzmaßnahmen sieht. Durch Gemeinschaftswerbung sollten die weitgehend separat agierenden Naturschutzverbände, obwohl im Deutschen Naturschutzring (DNR) zusammengeschlossen, in einer `Strategie der kleinen Schritte´ nicht nur an einem Strang, sondern auch in die gleiche Richtung ziehen.
Das reine Vermitteln von Sachwissen als Aufgabe der Umweltverbände reicht dem RSU (1996a, 34) nicht mehr aus. Er ist der Auffassung, daß sie in Zukunft zum einen auf eine Integration individual-, sozial- und umweltverträglichen Handelns hinwirken sollten; monokausal ausgerichtetes, rein naturschutzfachliches Denken würde damit der Vergangenheit angehören. Zum andern geht es wesentlich mehr um die Verdeutlichung der Abhängigkeit unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems von einem funktionierenden Naturhaushalt. Das `Mensch braucht Natur´-Bild muß stärker in die Gesellschaft getragen werden, da eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung nur mit, aber nicht gegen Naturressourcen möglich ist.
Die oben bereits mehrfach zitierte Studie von Kaule et al. (1994) betont die Notwendigkeit von Kommunikation und Akzeptanz. Die Bedeutung von Akzeptanz hat auch Kiemstedt erkannt, der unter Bezugnahme auf andere Planungskategorien einen Wandel der Sichtweisen auch in der Landschaftsplanung fordert:
"In der Stadt- und Regionalplanung ist seit längerem eine Entwicklung im Gang, die wegführt von finalen Plänen i.S. der Darstellung von angestrebten künftigen Zuständen, die Planung mehr als offenen Prozeß der Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Betroffenen versteht und den Planern eine Initiator- und Moderatorenfunktion bei der Konfliktlösung beimißt. Es wird höchste Zeit, daß die Landschaftsplanung sich dieser Einsicht anschließt, gerade auch um mehr Akzeptanz zu gewinnen" (1993, 92).
Die hier angesprochene Initiator- und Moderatorenfunktion von Landschaftsplanern in einem Kommunikationsprozeß greift Geisler (1995) auf und fordert von der Landschaftsplanung, angesichts eines steigenden Regelungsbedarfs ökologischer Notwendigkeiten und ökonomischer Ansprüche eine Moderatorenrolle für die ökologischen Gesichtspunkte in der Raumplanung zu übernehmen.
In ihrem Modell zur Kommunikation in der Landschaftsplanung, das in Abbildung 3 wiedergegeben ist, fassen Kaule et al. die bisher skizzierten Perspektiven zusammen. In einer Vorphase werden, neben der Erhebung der landschaftsökologischen Parameter auch eine Akzeptanzuntersuchung bei den beteiligten Entscheidungsträgern, Vertretern unterschiedlicher Interessengruppen sowie Betroffenen vorgeschlagen, um eine `Schubladen-Planung´ zu vermeiden. Die Hauptphase mit der Aufgabe der Projektsteuerung wird bestimmt von er- und vermitteln: Kommunikation der Beteiligten untereinander am `Runden Tisch´ (siehe hierzu Kapitel 3.4.5) führt zu Informations- und Wissensaustausch und Interessenbündelung.
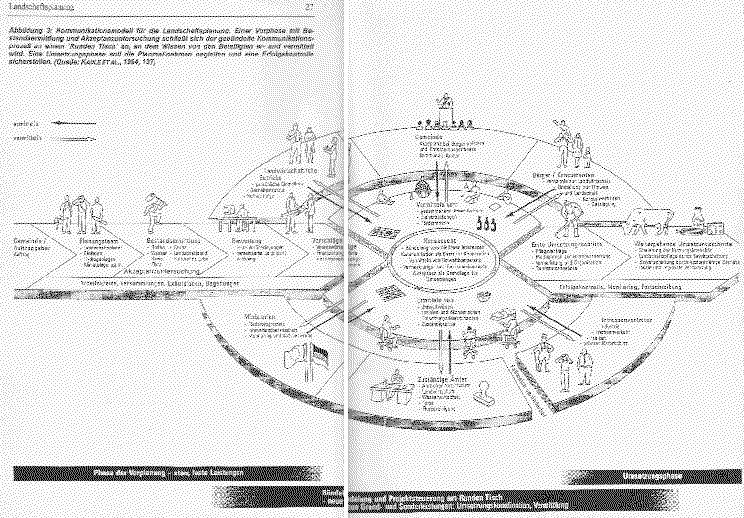
Abbildung 3: Kommunikationsmodell für die Landschaftsplanung. Einer Vorphase mit Bestandsermittlung und Akzeptanzuntersuchung schließt sich der gebündelte Kommunikationsprozeß an einem `Runden Tisch´ an, an dem Wissen von den Beteiligten er- und vermittelt wird. Eine Umsetzungsphase soll die Planmaßnahmen begleiten und eine Erfolgskontrolle sicherstellen. (Quelle: Kaule et al., 1994, 137)
Die Umsetzungskoordination und die Vermittlung, die der Planer zusätzlich erbringt, wird über Grund- und Sonderleistungen der HOAI abgerechnet. Durch Beteiligung relevanter Kreise, die ebenfalls Wissen, insbesondere Ortskenntnisse beisteuern können, werden Informationsdefizite abgebaut. Akzeptanz als Grundlage für das weitere Vorgehen führt zu Umsetzungsschritten, in denen Landwirtschaft und Naturschutz, hier im Beispielsfall durch Pflegeverträge, Tourismuseinkünfte oder dezentrale Vermarktung, voneinander profitieren können.
Die Beteiligung der Landwirte als Flächeneigentümer oder Pächter ist bei diesem kooperativen Modell ein elementarer Baustein. Auf die Bedeutung von Bürgerbeteiligung für die Umsetzung in der Landschaftsplanung haben auch schon früher andere Autoren hingewiesen. Rathfelder forderte 1984 (501) bereits, die Frage der Bürgerbeteiligung an der Landschaftsplanung zu prüfen. Aus seinen Erfahrungen in Baden-Württemberg berichtet er, daß Versuche der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern erfolgreich verlaufen sind, wobei er die daraus entstehende Motivation für die spätere Umsetzung von Maßnahmen als wesentlich erachtet. Peters (1987) hat in seinem Planungsmodell für einen bürgernahen Landschaftsrahmenplan in Niedersachsen die permanente Rückkoppelung der Beteiligten über den vorgesehenen Soll-Zustand (vgl. Kapitel 3.3.1) und die maximale Beteiligung der Öffentlichkeit, insbesondere die des einzelnen Bürgers, als entscheidende Kriterien hervorgehoben. Kaule et al. (1994, 133; vgl. auch Kapitel 1) haben das Mediationsverfahren als ein Verfahren genannt, daß zur Kommunikation und zur Akzeptanzgewinnung in der Landschaftsplanung geeignet sein könnte.
Die Notwendigkeit von Akzeptanz, Kommunikation und Beteiligung ist aus
dem bisher ausgeführten deutlich geworden. Im folgenden sollen Instrumente vorgestellt
werden, die zur Kommunikation und Kooperation vor Ort hilfreich sein können. Oppermann
(1997; vgl. auch Renn/Oppermann (1995)) schlägt `Runde Tische´, Arbeitskreise,
Mediationsverfahren, Planungszelle und Zukunftswerkstatt als Instrumente
umsetzungsorientierter Landschaftsplanung vor, wie sie in einer selbsterklärenden
Übersicht in Tabelle 5 zusammengestellt
sind. Der `Runde Tisch´ hat sich, nach der politischen Wende in der DDR, als
Sammelbegriff
Tabelle 5: Beteiligungsverfahren in der Landschaftsplanung im Vergleich. Der Runde Tisch als Begriff gewann im Zuge der politischen Wende der DDR Bedeutung für direkte Bürgermitwirkung und gilt heute als Sammelbezeichnung für kooperative Beteiligungsverfahren. (Quelle: Oppermann, 1997, 78)
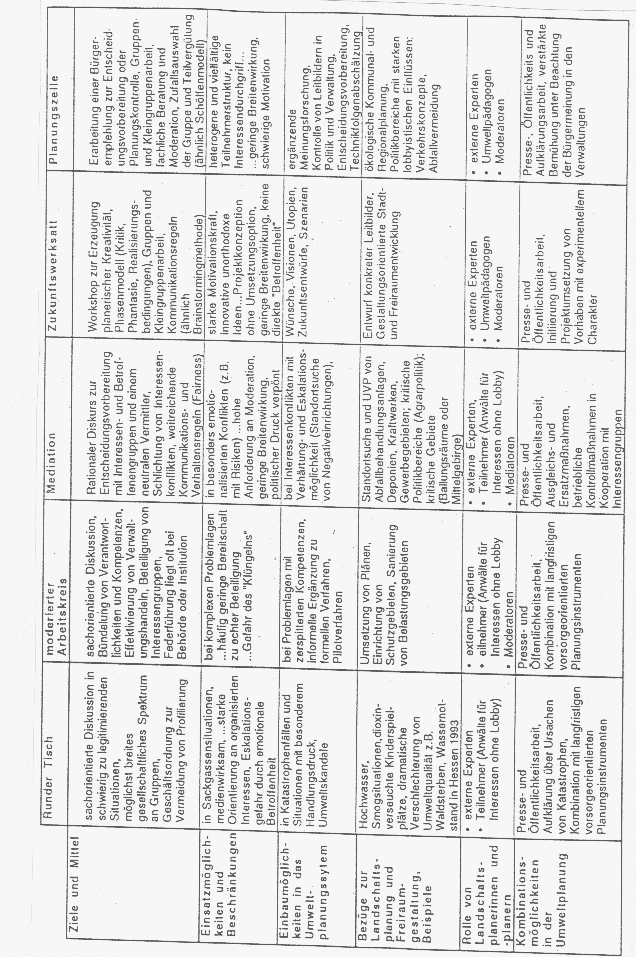
für kooperative Beteiligungsverfahren der direkten Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik etabliert für (vgl. Probst, 1993, 97ff.).
Kooperative Planung soll hier und im folgenden verstanden werden als Verfahren, in der frühzeitige und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Beteiligten über die zu tätigenden Aktionen erfolgt, welche gemeinsam und in Absprache mit den Betroffenen durchgeführt werden. Die Absprachen werden getätigt auf einem verfahrenseigenen informellen Kommunikationsforum, z.B. einem Runden Tisch, einem Arbeitskreis oder einer Mediationsrunde.
Home - Inhalt - Kap. 1 - Kap. 2 - Kap. 3 - Exkurs - Kap 4. - Kap. 5 - Kap. 6 - Kap. 7 - Kap. 8 - Kap. 9 - Anhang